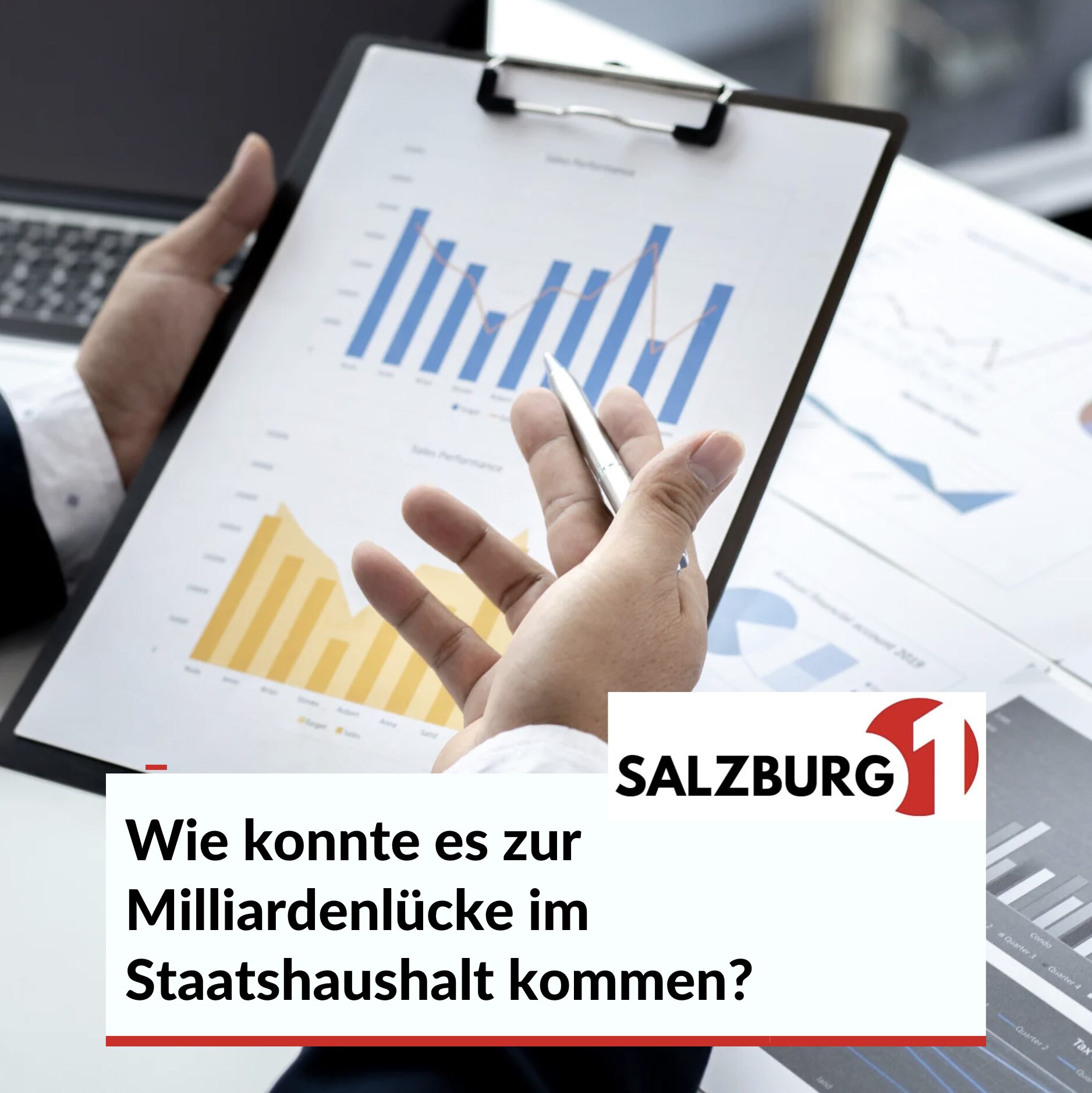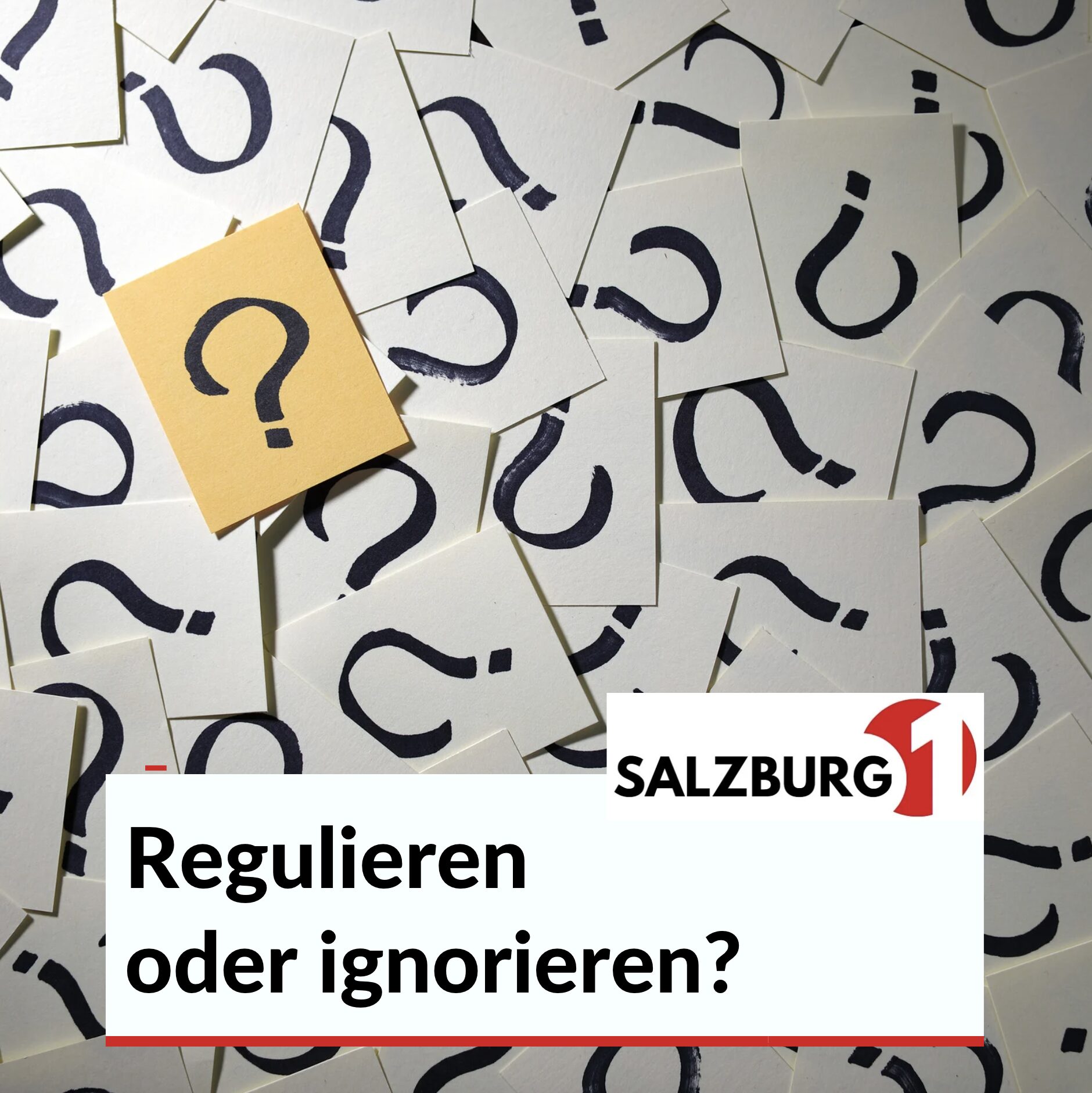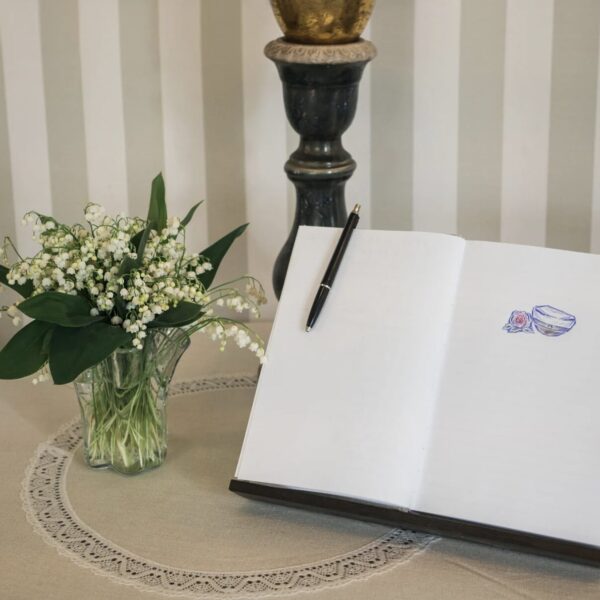Die Zahlen sind eindeutig und sie sprechen eine Sprache, die man auch ohne Taschenrechner versteht. Österreich fehlt Geld, und zwar nicht zu knapp. Laut Schätzungen des Finanzministeriums klafft derzeit eine Lücke von rund zwölf Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Kein Pappenstiel, sondern ein klares Warnsignal.
Die Einnahmen halten mit den steigenden Ausgaben nicht mehr Schritt, was die Regierung zu unbequemen Entscheidungen zwingt. Sparen allein wird nicht reichen, das ist längst klar. Also geht es um die große Frage, woher die Milliarden kommen sollen?
Ein Bereich, der jedenfalls zunehmend ins Visier des Finanzamtes gerät, ist das Glücksspiel. Besonders Online-Casinos gelten als schwer zu kontrollierendes Steuerpotenzial mit wachsendem Marktanteil und wie man auf der Website Casino Groups nachlesen kann, erzielen zahlreiche internationale Anbieter erhebliche Einnahmen mit österreichischen Spielern, obwohl viele von ihnen keine nationale Lizenz besitzen.
Wie konnte es zur Milliardenlücke im Staatshaushalt kommen?
Die Gründe für das drohende Finanzloch sind vielseitig und stapeln sich wie unbezahlte Rechnungen auf einem chaotischen Schreibtisch. Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen, gefolgt von Teuerungen, Energiekostenexplosionen und einem Zinsanstieg, der die Schuldendienstlast aufbläht wie ein Hefeteig.
Dazu kommt, dass die Babyboomer-Generation langsam in Pension geht, was das Sozialsystem stärker belastet als je zuvor. Gleichzeitig sorgen die üblichen automatischen Ausgabensteigerungen, Stichwort Valorisierung, dafür, dass sich der Haushalt jedes Jahr ein Stück weiter aufbläht, selbst wenn niemand zusätzliche Maßnahmen beschließt.
Dass das Defizit plötzlich nicht mehr bei sechs, sondern bei zwölf Milliarden Euro liegt, liegt auch an Einmaleffekten, die nun auslaufen. Etwa Einnahmen aus Sondereffekten in der Krise, oder Ausgabenverschiebungen, die nur kurzfristig geholfen haben. Inzwischen zieht sich der Nebel zurück und legt frei, was bleibt. Eine strukturelle Lücke, die sich nicht mehr einfach weglächeln lässt.
Neue Steuern, alte Hoffnungen
Ein Blick in das Regierungsprogramm 2025–2029 zeigt, wo die politischen Entscheidungsträger neue Einnahmequellen erwarten. Die Bankenabgabe wurde erhöht, ebenso plant man stärkere Beiträge von Energiekonzernen, die in den vergangenen Jahren mehr als üppige Gewinne eingefahren haben.
Auch Share Deals, also der steueroptimierte Erwerb von Immobilien über Gesellschaftsanteile, sollen künftig stärker besteuert werden. Das klingt vielversprechend, zumindest auf dem Papier.
Die Bankenabgabe etwa soll rund 500 Millionen Euro jährlich bringen, die Energiekrisenbeiträge etwa 200 Millionen. Hinzu kommen mögliche Mehreinnahmen aus Anpassungen bei der Körperschaftsteuer, der Stiftungsbesteuerung und Immobilienabgaben.
Wie stabil diese Einnahmen sein werden, ist aber eine andere Frage. Einmalige Sonderbeiträge verpuffen schnell, sobald die Großwetterlage in Politik oder Wirtschaft wechselt und viele dieser Maßnahmen sind in der Umsetzung komplex oder juristisch angreifbar, was ihre Wirksamkeit verzögern kann. Einnahmen wird es also geben, aber ob daraus eine dauerhafte Lösung wird, bleibt abzuwarten.
Glücksspielanbieter als Goldesel?
Inmitten dieser fiskalischen Schatzsuche rückt der Glücksspielsektor immer stärker in den Blick und hier vor allem der Teil, der sich außerhalb der offiziellen österreichischen Lizenzlandschaft bewegt. Denn während win2day als staatlich reguliertes Online-Casino brav seine Abgaben leistet, tobt im Graubereich ein Markt, der sich in Volumen und Reichweite längst nicht mehr verstecken muss. Internationale Anbieter mit Sitz in Malta, Gibraltar oder auf den Antillen bedienen österreichische Kunden in großem Stil. Oft am Rande der Legalität, manchmal darüber hinaus.
2019 lagen die Bruttospieleinnahmen dieser nicht-lizenzierten Anbieter bei geschätzt 308 Millionen Euro, im Vergleich dazu erwirtschaftete win2day etwa 95 Millionen. Auch aktuell sind diese Größenverhältnisse kaum geschrumpft.
Schätzungen zufolge erwirtschaften illegale Online-Anbieter pro Quartal derweil rund 38 Millionen Euro mit österreichischen Nutzern. Das entspricht etwa 150 Millionen Euro pro Jahr. Ein großer Teil davon rauscht an der Steuerkasse einfach vorbei.
Warum mehr nicht immer gleich mehr bedeutet
Wer glaubt, dass Steuererhöhungen das einfache Allheilmittel sind, irrt allerdings gewaltig. Höhere Steuersätze führen in der Realität nicht automatisch zu höheren Einnahmen. Manchmal sogar zum Gegenteil.
Wenn Unternehmen das Gefühl bekommen, zur Melkkuh degradiert zu werden, überlegen sie sich genau, ob sie in einem Land investieren wollen, in dem ständig neue Abgaben drohen. Auch Bürger reagieren oft sensibel. Wer das Gefühl hat, dass ihm der Staat zu tief in die Tasche greift, sucht nach legalen oder zumindest nicht gänzlich illegalen Schlupflöchern.
Wer trägt den Großteil der Steuerlast?
Kaum ein Thema entfacht so schnell gesellschaftlichen Zündstoff wie die Frage nach Steuergerechtigkeit. Wer soll für die Haushaltslücke bezahlen? Die großen Konzerne mit ihren globalen Steuertricks oder die Superreichen mit Milliardenvermögen, die in Trusts und Stiftungen geparkt sind? Oder doch wieder der Mittelstand, der keine Schlupflöcher kennt und bei jeder Reform murrend zur Kasse gebeten wird?
Im aktuellen Regierungsprogramm finden sich keine Vermögenssteuern. Auch die Erbschaftssteuer bleibt ein Tabu. Stattdessen liegt der Fokus auf Abgaben, die strukturell leichter umsetzbar sind, aber eben auch jene treffen, die ohnehin schon stark belastet sind. Indirekte Steuern wie die Mehrwertsteuer oder Energiesteuern belasten gerade Menschen mit geringem Einkommen überproportional. Wer auf Gerechtigkeit pocht, muss auch diese Schieflagen sehen, nicht nur das große Ganze.
Regulieren oder ignorieren?
Ein illustratives Beispiel für steuerpolitisches Wegschauen ist die österreichische Onlineglücksspielbranche. Obwohl der Markt boomt, fehlt es an klarer Regulierung. Sportwetten gelten beispielsweise weiterhin nicht als Glücksspiel. Dadurch gelten andere Regeln, andere Steuersätze und auch der Spielerschutz ist schwächer ausgeprägt.
Zudem können Anbieter ohne österreichische Lizenz agieren, solange sie ihre Server im Ausland betreiben. Das öffnet Tür und Tor für eine Schattenwirtschaft, deren Einnahmen weder sauber erfasst noch zuverlässig besteuert werden. Dem Fiskus entgehen dadurch Millionen und gleichzeitig wird ein Sektor ignoriert, der soziale Folgekosten durch Spielsucht oder Schuldenprobleme verursacht.
Eine Reform dieses Bereichs könnte Einnahmen sichern, Rechtssicherheit schaffen und zugleich zeigen, dass der Staat auch in digitalen Grauzonen handlungsfähig bleibt.
Wo Österreich wirklich ansetzen kann
Die Haushaltslücke von zwölf Milliarden Euro ist eine sehr reale Herausforderung. Wer sie schließen will, muss an vielen Stellschrauben drehen. Es braucht ein Einnahmenkonzept, das auf mehreren Säulen ruht wie besserer Regulierung von Sektoren wie Glücksspiel, Reform bestehender Steuermodelle und punktuellen Abgaben, wo sie sozial vertretbar sind und nachhaltig wirken.
Was es nicht braucht, sind populistische Schnellschüsse, symbolische Reichensteuern ohne Substanz oder ein überambitioniertes Steuerprogramm, das mehr Vertrauen kostet, als es Einnahmen bringt.